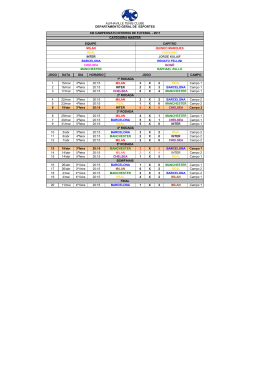Gottesfriede und Treuga Dei im Spiegel zeitgenössischer Rechtspraxis und Dichtung in Frankreich und Spanien Thomas Gergen Europäische Rechtsgeschichte und Kirchenrecht Die rechtshistorisch bedeutsamste Wirkung der hochmittelalterlichen Friedensbewegung lag in der „Kriminalisierung des Strafrechts“, denn das Delikt wurde nicht mehr als Eingriff in die Rechte eines anderen betrachtet, der mit Buße zu sühnen war, sondern als Bruch des Friedens, der mit peinlicher Strafe, also mit Leibes- oder Lebensstrafe vergolten werden musste. Hier setzte das DFG-Forschungsprojekt „Die Entstehung der Strafe im Hochmittelalter“ an, das in Saarbrücken von Professor Dr. Elmar Wadle durchgeführt wurde und an dem der Autor beteiligt war. Hervorzuheben waren dabei der kirchliche Ursprung der Gottesfrieden und die von den Erzbischöfen und Bischöfen geforderte und geförderte Verbreitung der Grundregeln zum Schutz der Kirchen, ihrer Leute und Güter sowie die Ausbreitung und Anreicherung dieser Gebote um weitere Friedensräume und Friedenszeiten einschließlich ihrer Zu- Wenn man heute das Wort „Treuga“ hört, denkt man zunächst an den aus der Antike stammenden Frieden zur Zeit der Olympischen Spiele, während derer keine Kriegshandlungen vorgenommen werden durften oder an Waffenstillstände, die zwischen einzelnen Konfessionen oder Nationen ausgehandelt werden, wie etwa der Friede von Ulster in Nordirland oder die Treuga (Tregua) zwischen baskischen Separatisten (ETA) und dem spanischen Staat. Zu allen Zeiten hat es also Waffenstillstände gegeben, die für eine gewisse Zeit vereinbart und entweder eingehalten oder gebrochen wurden. Auch im Mittelalter, insbesondere seit der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, gab es solche Waffenstillstände, die sich - für die damalige Zeit üblich - an kirchlichen Hochfesten wie etwa Weihnachten, Ostern und gewissen anderen Hochfesten von Heiligen orientierten. Wer an diesen Tagen eine Fehde ausfocht, wurde besonders hart bestraft. Aus dieser Reglementierung ergibt sich, dass die Fehde nicht ganz abgeschafft wurde, sondern auf gewisse Tage verteilt und damit in gewissem Umfang legitimiert wurde. Die Vorläufer der Treuga Dei waren die Gottesfrieden (Pax Dei), wobei die Frieden für das Bistum Lüttich (1082) und der Kölner Gottesfrieden (1083) die ersten auf deutschem Boden waren. sammenhänge mit den Vorschriften karolingischer Kapitularien und zeitgenössischer Beschlüsse von Konzilien und Synoden. All dies legt den Gedanken einer großräumigen Rechtsangleichung nahe. Zum anderen wird der praktische Niederschlag der Friedensregeln, so etwa in der kirchlichen Bußpraxis und in der Verbreitung bestimmter Institutionen thematisiert, bevor dann noch künftige Forschungsdesiderate beschrieben werden. Großräumige Rechtsangleichung Abb. 1: “Gerechtigkeit und Friede küssen sich” (Psalm 85/84, Vers 11). Darstellung an der Kirche Notre-Dame-la-Grande, Westfassade, Poitiers magazin forschung 2/2003 Die Beschäftigung mit den Gottes- und Landfrieden in Deutschland führte zu deren Wurzeln, die im französischen Aquitanien liegen. Im Jahr 975 ergriff Bischof Guido von Le-Puy eine erste friedensstiftende Maßnahme, indem er alle Angehörigen seiner Diözese, milites und rustici, darauf verpflichtete, den Frieden zu respektieren, keine Kirchen zu überfallen und die Güter der pauperes (d.h. der sozial und wirtschaftlich Abhängigen in der mittelalterlichen Gesellschaft) zu respektieren sowie die Opfer zu entschädigen. Auf den Widerstand hin ließ der Bischof seine Truppen kommen und die Anwesenden den Frieden vor Gott schwören. Während Le-Puy eine konkrete Friedensmaßnahme darstellt, formulierten die in Charroux versammelten Bischöfe im Jahre 989 abstrakte Friedensregeln. Die Bestätigung dieser Regeln auf dem Konzil 15 von Poitiers (1000-14), das nicht vom Erzbischof von Bordeaux, sondern vom Grafen von Poitiers und Herzog von Aquitanien Wilhelm dem Großen einberufen wurde, sowie die Wiederholung verwandter Normierungen auf den Konzilien von Limoges (994), LePuy (994), Beauvais (1023) etc. legten die Vermutung nahe, dass die Friedensregeln eine möglichst große Verbreitung in den Diözesen entfalten sollten. Für die zeitlich vorgelagerten Kapitularien etwa ist erwiesen, dass sie öfters wiederholt wurden, um ihnen zur Befolgung zu verhelfen. Eine solche Tendenz dürfte auch den Gottesfrieden, die an den karolingischen Friedensbegriff anknüpften, inhärent gewesen sein. Zu dem Gesichtspunkt der Wiederholung gesellt sich ferner der der räumlichen Geltung. Die Forschungen von Dietmar Willoweit1), der von einem durch die Versammlungen geschaffenen “befriedeten Binnenraum” spricht, sowie die Studien über die geographische Verbreitung der Friedensregeln, die Hans-Werner Götz2) vorlegte, führten zur Untersuchung, ob die Gottesfrieden eine gewisse Rechtsharmonisierung bzw. Normvereinheitlichung in gedachten oder existierenden Territorien und juristisch-administrativen Einheiten (Diözesen und Grafschaften) nach sich zogen. Obwohl es sich dabei um einen sehr modernen Begriff handelt, der uns aus dem internationalen Recht bzw. Europarecht geläufig ist, kennt auch die Rechtsgeschichte Belege für das Bestreben, Recht anzugleichen oder sogar zu vereinheitlichen. Die berühmte Klage des Bischofs Agobard von Lyon in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts zeigt z.B., dass der Wille, einheitliches Recht für möglichst viele Personen zu schaffen, auch im Mittelalter vorhanden war. Eine solche Sichtweise ist zwar für die Gottesfrieden denkbar, doch nicht uneingeschränkt gültig; die Serie von Texten über die Frieden spiegelt eher eine „Bestätigung“ von gewissen schon existierenden Bestimmungen wider, die im 11. und 12. Jahrhundert nach und nach angeglichen und je nach Gebiet und Bedarf verfeinert wur- Abb. 2: Übersicht über Bistümer, Erzbistümer und Abteien im mittelalterlichen Frankreich. 16 den. Gerade unter diesem von der historischen Forschung noch wenig beachteten Aspekt waren die Gottesfrieden unter die Lupe zu nehmen. Abstrakte Voraussetzung dafür war, dass es einen Bekundungsakt des geltenden Rechts gab, das bestätigt und in mehreren verschiedenen Rechtseinheiten (Diözesen und Grafschaften) angewendet wurde3). Die Regeln, die die Bischöfe 989 in Charroux (vgl. Abb. 2) aufstellten, sind als Normen zu qualifizieren, und sollten durch die Bischöfe kraft ihrer Autorität in den jeweiligen Diözesen umgesetzt werden. Es ging dabei um die Normen gegen Usurpation von Kirchengütern, gegen die Plünderer von pauperes sowie gegen den Überfall von Klerikern. Allen drei Kanones ist gemein, dass bei Zuwiderhandlung das Anathem ausgesprochen werden sollte, d.h. die in die feierliche Form der maledictio (Verfluchung) gekleidete Exkommunikation, den gänzlichen Ausschluss aus der kirchlichen Gemeinschaft4). Charroux stellt eine Bestätigung früheren Rechtes dar, denn die gleichen Rechtsinhalte sind karolingischen Kapitularien, den Volksrechten und den Konzilien jener Zeit nachgebildet; dies zeigen die parallelen Bestimmungen der Konzilien von Orléans von 511 bis 549, Tours 567, Mâcon 585, Paris 614, Quierzy 857, Ver-sur-Launette 884 und Metz 893, die gleiche Tatbestände aufweisen. Wenn die Autoren der Frieden vor allem auf die Kapitularien rekurrierten, dann wird nicht nur der konservative Charakter des Anliegens deutlich, sondern obendrein eine ordnungsund - modern gesprochen - eine polizeirechtliche Tendenz, denn die Kapitularien griffen nach ihrem Selbstverständnis nicht oder nur sehr vorsichtig in den Bereich eigentlichen „Rechts“ ein. Sie waren Verwaltungsordnung, Gebotsrecht im Bereich unmittelbarer Zuständigkeit des Herrschers oder der ihm verbundenen Kirche, Vorläufer der frühneuzeitlichen „guten Polizey“5). Neuere Studien zur Regionalgeschichte Aquitaniens haben ergeben, dass die Grafen von Poitiers bzw. Herzöge von Aquitanien, in Sonderheit Wilhelm der Große, einer karolingischen Herrschaftstradition folgten. Sie strebten mit ihrer Politik eine enge Zusammenarbeit mit der Kirche an, was sich insbesondere in der Suche nach Frieden, Gerechtigkeit und Einheit im vorgre- Universität des Saarlandes gorianischen Reformzeitalter manifestiert6). Herausgestellt wurde daneben, dass es sich bei der Friedensbewegung um eine Intensivierung früherer, vor allen Dingen karolingischer Normmodelle handelt, welche die aquitanischen Fürsten offenbar zurückwünschten. Die Gegenwart Wilhelms des Großen beim Friedenskonzil von Poitiers (1000-14) beweist den Schulterschluss von geistlicher und weltlicher Gewalt. Der Königsfriede Ludwigs VII. von Frankreich im Jahre 1155, der auf eine Dauer von zehn Jahren ausgelegt war, markiert für Frankreich das Ende der Bewegung, bevor die Friedensbestimmungen ganz in weltliches Recht übergingen. Aber zurück zum Anfang der Friedensbewegung, denn Charroux bestätigte nicht nur Kapitularien, sondern ebenfalls ähnlich lautende Bestimmungen der Bußbücher, die wiederum auf iroschottischer Tradition fußten und im Abendland weithin in Umlauf waren. Nachfolgende Konzilien bekräftigen und perpetuieren zudem die früheren. Das Konzil von Poitiers (1000-14), wo dieselben Bischöfe wie in Charroux auftraten (vgl. Abb. 3), erinnert nämlich in seiner Präambel sehr deutlich an das Konzil von Charroux: sicut in concilio Karrofense constitutum est7). Das Konzil von Bourges aus dem Jahre 1038 fügt sich explizit in die Tradition dieser Konzilien ein, indem es 50 Jahre zurückgeht und zugleich auf Charroux rekurriert: a quinto decimo anno et supra hac lege constringit. Als Mittel der Bestätigung der Gottesfriedensregeln begegnen uns einmal die Eidesleistung in Gegenwart von Reliquien und die Benutzung von rhetorischen Topoi, von denen die Friedenstexte übersät sind. Schließlich waren noch Beweise dafür zu sammeln, dass die Friedensnormen in bestimmten territorial orientierten Rechtseinheiten Geltung entfalten soll- Abb. 3: Die rechtsgeographische Dimension der Konzilien von Charroux und Poitiers auf Grund der Beteiligung der Bischöfe. magazin forschung 2/2003 ten. Dafür spricht die maßgebliche Beteiligung der Bischöfe, die in ihren Diözesen die iurisdictio, d.h. die Regierungsgewalt und insbesondere die Straf- und Disziplinargewalt über Laien und Geistliche ausübten und deren Kompetenz durch die jeweiligen Diözesangrenzen bestimmt war. Dass der Erzbischof von Bordeaux die Bischöfe seiner Erzdiözese gerade in Charroux zur Provinzialsynode zusammenrief, lag sicherlich an der zentralen Rolle, die die aufgrund ihrer wertvollen Reliquien und Privilegien prestigereiche Abtei seit der Karolingerzeit spielte. Im Beschluss der Provinzialsynode schimmert einerseits die hohe Bedeutung des Regelungsanliegens durch, denn obwohl jeder Bischof kraft seiner iurisdictio diese Regelungen hätte allein treffen können, fassten die anwesenden Prälaten einen Synodalbeschluss. Die Synode war nach mittelalterlichem Kirchenrecht und der gängigen Rechtspraxis als das höhere, zur Verwaltung der Strafgewalt berufene kirchliche Organ dazu befugt, die Rechte des niederen auszuüben, so dass dieser Beschluss gleichsam als Sammelbeschluss für die vertretenen Bistümer gewertet werden kann. Darüber hinaus oblag dem Erzbischof in der streng herausgebildeten kirchlichen Hierarchie die Appellationsinstanz über die Urteile seiner Bischöfe. Auf der anderen Seite gab es die Regel, dass die Verhängung eines Anathems nicht einem einzelnen Bischof zustand, sondern lediglich dem Metropoliten gemeinsam mit der Provinzialsynode8). Dabei war der Metropolit immer auch Erzbischof, jedoch nicht umgekehrt. Die erwähnte Anathem-Regel aus der Karolingerzeit war allerdings eher eine Ausnahme und nicht zwingend anwendbar, da sie weder im ganzen karolingischen Reich noch dauerhaft in Geltung gewesen war9). Daher war unerheblich, dass Erzbischof Gumbaldus von Bordeaux nicht auch Metropolit war. Da beim Konzil von Charroux alle Bistümer vertreten waren, versammelte sich die Provinzialsynode vollzählig und konnte die Normen für alle betroffenen Diözesen dekretieren: Nos ergo in Dei nomine specialiter congregati decrevimus. Nicht zuletzt konnten wir in diesem Zusammenhang zu Tage fördern, dass Gumbaldus nicht nur als Bischof von Bordeaux, sondern auch als Bischof von Agen zeichnete, da er dieses Bistum zu seiner Zeit mitverwaltete10). 17 Das große Engagement für den Frieden ist zudem durch zahlreiche Äußerungen der geistlichen Elite des Mittelalters belegt. Gelehrte wie Hinkmar von Reims und Odilo von Cluny oder auch Adémar von Chabannes und Yvo von Chartres setzten sich damit in Gebet und Geschichtsschreibung auseinander und ergriffen uneingeschränkt für ihn Partei. Bischof Oleguer von Tarragona (1069-1137) schließlich, ein Schüler des Reformordens von Saint-Ruf, mischte in dreifacher Weise in der Friedensbewegung mit, nämlich als Bischof von Barcelona, Erzbischof von Tarragona sowie als Berater bzw. „Kanonikerjurist“ und rechte Hand von Ramón Berenguer III., dem Grafen von Barcelona. Der Bischof von Barcelona fuhr zum Konzil von Reims, das 1119 die Treuga Dei bestätigte. Als nach Abschluss der „Reconquista“ erster Erzbischof von Tarragona nahm Oleguer sodann an den Konzilien von Clermont (1130) und Barcelona (1131) teil, die beide die Friedensnormen noch einmal einschärften. Nicht nur in Schriftform, auch in der Bildenden Kunst schlug sich die Friedensbewegung nieder, so z.B. in der Buchmalerei oder an Kapitellen. Ein Kapitell von Saint-Benoît-sur-Loire (vgl. Abb. 4) zeigt gegen Ende des 11. Jahrhunderts eine Wunderdarstellung: Ein seine Hände erhebender Bauer, den ein miles beraubt und der beim Kloster Schutz gesucht hat, freut sich über die wiedergefundene Freiheit dank eines einzigen Blickes von Sankt Benedikt (SaintBenoît). Dies weist auf die schon in karolingischer Zeit präsente Aufgabe der Kirche hin, die pauperes und deren Vermögen zu schützen. Die Darstellung macht plastisch, wie sich die Kirche, hier insbesondere die Klöster, den Aufgaben der Friedensbewegung im 11. und 12. Jahrhundert stellten. Das Bild fügt sich also gut zu den bereits oben erwähnten Normen der französischen Konzilien zum Schutze der pauperes. Niederschlag der Friedensregeln in der kirchlichen Bußpraxis Die einheitliche Bestrafung mit dem Anathem ungeachtet der Herkunft der Zuwiderhandelnden und der Gültigkeit in den jeweiligen Diözesen bezeugt letztlich, dass sich die Normgeber nicht mehr am Grundsatz der Personalität und der damit verbundenen Vielfalt der Gesetze11) orientierten, sondern dass sich der Territorialitätsgedanke durch- 18 Abb. 4: Die Friedensbewegung in der Bildenden Kunst (11. Jhd.) zusetzen begann. Das Hauptmotiv lag wohl darin, dass die Normschöpfer einheitlich gegen die Missstände ankämpfen wollten und es mithin keine Rolle mehr spielen sollte, wer diese tatsächlich verursacht hatte. Der ordre public, wie wir heute sagen würden, stand auf dem Spiel und gebot unter Aufgabe der Vielfalt der Gesetze eine Verbreitung desselben Gedankenguts in möglichst vielen Diözesen und Grafschaften. Evident ist gleichermaßen, dass die Fehde nicht ganz abgeschafft werden sollte, was von einem Tag auf den anderen auch nicht möglich war; man konnte die Friedensgebote lediglich auf bestimmte Zeiten und Orte beschränken. Diese Rolle übernahm ab den 40er Jahren des 11. Jahrhunderts die Treuga Dei, die sich in Mitteleuropa schnell ausbreitete. Ferner sollte die bestehende Ordnung in drei Stände (milites, clerici sowie laboratores) nicht umgestoßen werden, so dass die verkündeten Normen, die die Friedenswahrung anstrebten, zugleich dem Erhalt der damaligen Ständeordnung dienten; jeder einzelne Stand sollte seine Aufgaben ungestört erfüllen können. Während einige von „feudaler Revolution“ sprechen, nimmt Hans-Werner Goetz zurecht eine „Umordnung“ statt einer „Unordnung“ der damaligen Gesellschaft an12). Auf die Erhaltung dieser Ordnung pochten verschiedene Zeitgenossen, darunter Adalbert von Laon und Gerhard von Cambrai, worauf Georges Duby zu Recht seine These von der Sicherung der Stabilität in der Maison de Dieu gestützt hat, die es zu stabilisieren galt. Adalbert von Laon zeichnete das Bild einer „verkehrten“ Welt, in der der Bauer König wird, der Bischof Bauer und der Mönch Ritter. Dieser aus den Fugen geratenen Welt, wo die Gesetze zugrunde gingen, setzt Adalbert gewissermaßen in Nostalgie zur Karolingerzeit eine dreifunktionale Welt entgegen. In dieser hat Gott jedem exakte Funktionen zugeordnet, nämlich entweder die Aufgabe zu beten, zu kämpfen bzw. die Erde zu bearbeiten (milites, clerici sowie laboratores). Der Universität des Saarlandes König hat nach Adalbert die Aufgabe, die gesellschaftliche Balance im Gleichgewicht zu halten und damit den gesellschaftlichen Frieden zu garantieren. Als die Treuga Dei sich zu entwickeln beginnt, nimmt Gerhard von Cambrai die Idee der dreifunktionalen Gesellschaft auf. In seiner Vision von einem perfekten Frieden, der ein wahres Abbild des „himmlischen Jerusalems“ darstellt, lassen die milites für immer die Waffen fallen13). Damit diese streng dreigliedrige Gesellschaftsordnung nicht umkippte, sollten die Gottesfriedensregeln die Übergriffe der milites verhindern, um die beiden anderen Stände zu schützen. Im Gottesfrieden scheinen zwar die rechtlichen Aspekte zu dominieren, doch fließen in einer Zeit der „Offenheit“ des Rechts allgemeine Verhaltensregeln und theologisch fundierte Praxis zusammen14). Dies kann man an der Rolle des Eides und der zeremoniellen Gegenwart der Reliquien recht gut erkennen. Die Eidesleistung und der Schwur, vor Gott in Zukunft die Friedensregeln zu beachten, verbinden Mensch und Gott auf enge Weise und spiegeln den Ernst der Normierung wider. Für die Zeit des 11. und beginnenden 12. Jahrhunderts, also vor Entfaltung der Kanonistik ist es zwar noch sehr schwierig, zwischen Buße und Strafrecht zu unterscheiden15). Ein anderer Zusammenhang spiegelt sich indessen in der Bußdisziplin der Kirche wider und in ihrem „Angebot“, nach begangener Sünde unter Bußleistung wieder in ihren Schoß zurückzukehren und vor Gott geläutert dazustehen. So taucht gerade in den Gottesfrieden die Möglichkeit auf, die Schuld abzuwerfen, um danach für die Zukunft einen erneuten Friedeschwur einzugehen und zu beeiden. Die Idee, dass die Sünde die Abwesenheit oder das Fehlen des Guten darstellt und mithin eine Abkehr von Gott bedingt, ist augustinisch. Seine Definition, dass die Sünde ein Wort, eine Handlung oder ein Wunsch ist, die dem göttlichen Gesetz widersprechen, durchzieht die gesamte mittelalterliche Theologie und kann auch im Zusammenhang mit den Gottesfrieden ausgemacht werden. Der Mensch, der sich allerdings von Gott entfernt hat, kann aber deswegen wieder zu ihm und seiner Kirche zurückfinden, weil er als Gottes Ebenbild infolge der Mensch- magazin forschung 2/2003 Dr. Thomas GERGEN, Ass.iur., Maître en Droit, MA, DEA Civilisation Médiévale hat von 1991 bis 1998 deutsches, französisches und spanisches Recht sowie Romanistik und Geschichte in Saarbrücken, Poitiers, Barcelona, Salamanca, Durham und Lissabon studiert. 1998 wurde er als Übersetzer und Dolmetscher für die Gerichte des Saarlandes und die saarländische Notarkammer mit den Sprachen Französisch und Spanisch vereidigt. Zudem unterrichtete er deutsches Recht an der Rechtsanwaltskammer in Poitiers. In den Beiheften zur Zeitschrift für Romanische Philologie (Bd. 302) veröffentlichte er im Jahre 2000 seine Dissertation "Sprachengesetzgebung in Katalonien", mit der er 1998 von den Professoren Hans-Jörg Neuschäfer und Max Pfister zum Doktor der Philosophie promoviert worden war. Während seines juristischen Vorbereitungsdienstes war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Deutsche Rechtsgeschichte und Bürgerliches Recht bei Professor Dr. Elmar Wadle, unter dessen Betreuung er seine juristische Dissertation mit dem Thema "Juristische Praxis der Pax und Treuga Dei seit dem Konzil von Charroux (989-1250)" verfasste, die in Kürze in der “Rechtshistorischen Reihe” publiziert wird. Seit Abschluss des Assessorexamens arbeitet er bei Professor Wadle an seinen Habilitationsprojekten, die in erster Linie über Nachdruckprivilegien im Süddeutschland des 19. Jahrhunderts handeln. Ferner forscht Gergen über Entstehungsgeschichte und Rezeption des französischen Code civil von 1804 sowie im geltenden deutschen wie französischen Privatrecht. Er ist Autor zahlreicher Beiträge für die Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (ZRG), Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte (ZNR), Juristische Schulung (JuS), Zeitschrift der deutsch-spanischen Juristenvereinigung, Cuadernos de Historia del Derecho (Jahrbücher für Rechtsgeschichte) der Universidad Complutense in Madrid, sodann für die Revista de Llengua i Dret (Zeitschrift für Sprache und Recht) der katalanischen Verwaltungshochschule in Barcelona, den Cahiers de Civilisation Médiévale des Centre d´Études Supérieures de Civilisation Médiévale in Poitiers sowie Lusorama (Zeitschrift für Lusitanistik) und Zeitschrift für Katalanistik (ZfK). werdung Jesu Christi gesehen wird. Der Mensch ist zur Zusammenarbeit mit Gott berufen, bei deren Scheitern Sünde entsteht. Die Sünde kann jedoch durch die Buße gesühnt und ausgemerzt werden. Die Schuldhaftigkeit des Menschen leitet Augustinus aus der Erbsünde her, nach der alle Abkömmlinge Adams aufgrund dessen erstem Fehltritt (Erbsünde) sich versündigen können. Durch die Taufe erhält der Mensch dann die Gnade Gottes, mit deren Hilfe die Sünde getilgt werden kann16). Dieser Zusammenhang von Sünde und Schuld wird an einigen Urkundenbeispielen deutlich. Von besonderem Interesse ist eine Urkunde, in der es um die Lösung eines Konfliktes zwischen Wilhelm V. der Auvergne und der Abtei von Charroux geht. Der Graf, der um die Mitte des 11. Jahrhunderts an diese Abtei eine Schenkung pro remissione peccatorum nostrorum macht, will für seine Missetaten in angemessener Form Buße tun. Der Graf empfindet und äu- ßert tiefe Schuld (et meam considerans culpam). Man kann dies so auffassen, dass er sich mit der Abtei wieder versöhnen wollte, weil er und seine Vorfahren diese beraubt und mehrfach geschädigt hatten. Die Urkunde enthält vorab den allgemeinen Satz, dass sicher ist, dass Zerstörer von Kirchenraum auch Störer der Kirche Gottes sind (certum est quia violatoris sanctuarii sunt dissipatores ecclesiarum Dei)17). Die Usurpatoren von Kirchengut sollten „von ganzem Herzen“ büßen und Wiedergutmachung leisten (et earum raptores substantiarum ... nunquam profecto nisi resipuerint ac toto corde poenitendeo omnipotenti Deo satisfecerint in superna Christi recipientur ecclesia). Sollten sie dies allerdings nicht tun, dann würde eine maledictio (Verfluchung) erfolgen und sie würden „in äußerste Dunkelheit fallen“, was einer ewigen Verdammnis entspricht. Es fällt auf, dass eine solche maledictio auf dem Friedenskonzil 1031 vom Bischof von Limoges ausgesprochen wurde. Aber bereits in Charroux und Poitiers 19 hatten die Bischöfe den Friedebrechern das Anathem als Kirchenstrafe angedroht. nachweisen können, und zwar in Poitiers 1026 und 1036, in Charroux 1028 sowie in Limoges 1031. Anhand der erwähnten Urkunde kann man zum einen den Zusammenhang von Schuld, Sünde und Vergehen beobachten, die den Tatbestand der Usurpation von Kirchengütern, der auf den regionalen Konzilien thematisiert wurde, erfüllten, und zum anderen die praktische Anwendung und Rolle der Gottesfriedensnormen nachweisen. Anhand dieses Falles kann also die Anwendung der abstrakt formulierten Friedenskonzilien auf einen konkreten Konfliktfall nachgezeichnet werden, bei dem es zu keinem Gerichtsverfahren gekommen und der mithin mit den „Spielregeln der Politik“ gelöst worden war. Wir können daraus ebenso folgern, dass die Regeln der Gottesfriedenstradition in die Kartularienpraxis Einzug gehalten hatten. Sie wurden zwar nicht explizit (Wort für Wort, Satz für Satz) erwähnt; dies bedeutet jedoch nicht, dass sie nicht angewandt wurden, denn auch das römische Recht oder das Gewohnheitsrecht wurden nicht eigens genannt, wenn man sich auf sie stützte. Im 10. bis 12. Jahrhundert spielten Überlieferung, Herkommen und Gewohnheit die dominierende Rolle, das schriftlich aufgezeichnete Recht eine untergeordnete. Die „Gemengelagen von Rechtsgewohnheit, verschriftlichtem und nichtschriftlichem Juristenrecht, Rechtsaufzeichnung, obrigkeitlichem Gesetz und Gewohnheitsrecht“ verschob sich zusehends zugunsten der Schriftlichkeit, und das mittelalterliche schriftlose Recht war im Ganzen gesehen „Überzeugungsrecht“18). Da das örtliche Gewohnheitsrecht („coutumes de Charroux“) erst auf 1177 datiert wird, ist es sogar eher wahrscheinlich, dass die Friedensregeln, die noch immer in den Köpfen der Menschen vorhanden waren, im 11. Jahrhundert für die Lösung einschlägiger Konflikte bemüht wurden und eine Rechtslücke schließen konnten. Nicht nur die zeitliche und örtliche Nähe der Urkunde zu den Frieden in der Umgebung von Charroux (989), LePuy (994), Poitiers (1000-14) und Limoges (994, 1028, 1031) sprechen für die Verwobenheit mit den Gottesfrieden, auch eine inhaltliche Analyse kann diese These bekräftigen. Wie der erste Kanon des Konzils von Charroux ausführt, wird gegen die Räuber von Kirchen und Angreifern von Klerikern, die keine Waffen tragen, das Anathem verhängt, sollten sie keine Wiedergutmachung leisten. Die zuwiderhandelnden Friedebrecher sollten schließlich an der Schwelle der Kirche zurückbleiben (a liminibus sanctae Dei Ecclesiae habeatur extraneus). Diese Formulierung, die schon aus der Karolingerzeit bekannt ist, verdeutlicht, dass es sich nicht nur um eine Sünde (peccatum), sondern darüber hinausgehend um ein Delikt (crimen) handelt, das die gänzliche Abtrennung von der Gemeinschaft der Gläubigen zur Folge hat (Anathem). Der einfache Sünder dagegen wird nur von den Sakramenten ausgeschlossen, verbleibt aber in der Gemeinschaft, die für seine Rückkehr beten soll. Wilhelm V. der Auvergne, der den Tatbestand der Usurpation von Kirchengut gemäß den Kanones des Konzils von Charroux erfüllt hatte, nahm das Angebot zur Wiedergutmachung (satisfactio) wahr, damit kein Anathem gegen ihn ausgesprochen werden sollte. In der Urkunde sind überdies zwei wichtige Personen namentlich erwähnt; dies verleiht ihr zusätzliche Bedeutung, denn beide spielten für die Friedensbewegung eine außerordentliche Rolle. Es sind dies Leo IX., der eine aktive Position beim elsässischen Frieden von 1094/95 (pax alsatiensis), seiner Herkunftsregion, einnahm; als zweite Persönlichkeit begegnet uns der Bischof von Poitiers Isembert I., den wir bis 1047 auf allen Gottesfriedenskonzilien 20 Diese Zusammenhänge lassen sich ebenso aufzeigen an Hand zweier Auseinandersetzungen mit der Familie von Rochemeaux, die in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts von ihr usurpiertes Gut an die Abtei von Charroux restituierte, um zu ihr und der Gemeinschaft der Gläubigen zurückzufinden; zwecks Aussöhnung vollzogen einige Familienangehörige als Bußleistung eine entsprechende Schenkung an die Abtei19). Sichtbare Ausformung der Friedensbemühungen Auf der Suche nach Spuren von Institutionen der Friedensbewegung fallen so- fort die im Süden Frankreichs und in Katalonien verbreiteten Schutzräume auf. Dabei handelt es sich um „heilig“ erklärte Zonen, die im allgemeinen als 30-Schritt-Zone um eine Kirche auftreten und sacraria (katalanisch: sagrera) genannt werden. Sie sind als architektonisch sichtbare Ausformungen der Friedensbemühungen anzusehen und ergänzen insoweit das Bild der praktischen Bestätigung der Friedensnormen in der mittelalterlichen Gesellschaft. Nach außen und für illiteratae erkennbar sollte sein, welche Bereiche für sie unantastbar waren und keine eigenmächtigen Eingriffe duldeten. Die rechtliche Bedeutung ist groß, da diese Friedenszonen stets Gegenstand der katalanischen Friedenskonzilien waren, wobei das erste 1027 in Toulouges bei Elne (vgl. Abb. 2 unten) abgehalten wurde20). Schon das Vokabular dieser Friedenszonen, die in den Konzilien und im späteren Gewohnheitsrecht Kataloniens (Usatges de Barcelona) vorkommen, ist auffällig. Es gibt eine echte „Texttradition“ der Formeln von pax et treuga (katalanisch pau e treva) und der 30-Schritt-Zone, die man zum ersten Mal auf dem 12. Konzil von Toledo im Jahre 681 ausfindig machen kann und die für Schutz suchende Flüchtige einen Sicherheitsbereich um die Kirche festlegte. Die Kirche sanktionierte die Verletzung des Asyls mit Exkommunikation und der Androhung einer Strafe durch den König. Die Texttradition führt über die katalanischen Konzilstexte (sacraria) bis in das Gesetzbuch von Barcelona (Usatges) hinein (12./13. Jh.). Die Attribute von pax und treuga sind Ecksteine beim Aufbau der noch jungen Grafschaft von Barcelona und Kataloniens und bezeichnen allgemeinen Frieden. Bemerkenswert ist, dass die Usatges de Barcelona nicht nur die Paarformel pax et treuga beinhalten, sondern ebenfalls die beiden Attribute jeweils allein21). So wie die Usatges von der vergangenen Konzilstradition Kataloniens geerbt haben, hat auch Eike von Repgow bei der Verfassung des Sachsenspiegels auf vor seiner Zeit liegende Friedensbestimmungen rekurriert und mithin überliefertes Recht wiedergegeben (vgl. Landrecht II, 66 und 69)22). Die Betrachtung der französischen und katalanischen Frieden für den Zeitraum von drei Jahrhunderten (11.-13. Jh.) bestätigte die grundlegende rechtliche Bedeutung der Friedensbewegung von den frühen Gottesfrieden bis hin zu den Universität des Saarlandes Landfrieden und dem Gewohnheitsrecht. Für Deutschland wurden prominente Fälle für die praktische Bedeutung einzelner Friedenstexte geliefert; die Ermordung des Bischofs Godrich von Laon oder des Erzbischofs Engelbert I. von Köln repräsentieren beste Fälle für die Annahme, dass Landfriedenstexte bei der Bestrafung der Mörder zur Anwendung kamen, etwa das Rädern für Engelberts Mörder23). Ebenso ist der Überfall auf Bischof Lambert von Arras (1093-1115) ein geeignetes Beispiel, um zu zeigen, dass Landfriedensbestimmungen in der rechtlichen Praxis der damaligen Zeit herangezogen werden konnten. Lamberts Korrespondenz ist von Begriffen der Friedensbewegung stark durchsetzt, etwa den Friedensstatuten, in denen die Atrien um die Kirchen durch die Pax Dei geschützt wurden. In seinen Briefen setzt er sich gleichermaßen für die Verurteilung beraubter Pilger aus seiner Diözese ein und wendet dabei die statuta pacis an. Diese Friedensregeln wurden 1091 auf dem Konzil von Soissons proklamiert. Im Jahre 1095 wird Lambert, als er sich auf dem Wege zum Konzil von Clermont (1095) befand, selbst Opfer einer Aggression, als er von Guarnerius von Pont, dem Bruder des Bischofs von Troyes, gefangen genommen und mehrere Tage in Gewahrsam gehalten wurde. Diese Episode wird innerhalb seines Reiseberichtes detailreich geschildert. Interessanterweise finden sich in Lamberts Notizen just die Bestimmungen des Konzils von Clermont, die von Übergriffen gegen Geistliche handeln, in Sonderheit die Gefangennahme von Bischöfen, so als ob Lambert selbst einen verwandten Fall bzw. eine kirchenrechtliche Grundlage für seinen eigenen Fall gesucht hätte. Kanon 32 sieht nämlich für denjenigen, der einen Bischof gefangen hält, die ewige Infamie (Ehrlosigkeit, Schmach, Schande) sowie die Ablegung seiner Waffen vor. Diese Norm folgt der Bestimmung nach, die die Rechtsfolgen des Raubes der Güter nach dem Tod des Bischofs regelt und mit dem Anathem bestraft; hier handelt es sich um Strafen, die einen sozialen Abstieg in der Gesellschaft bedeuteten. Das Beispiel des Bischofs Lambert von Arras zeigt, dass sein Schriftverkehr nicht nur vom Friedensvokabular durchdrungen ist, sondern er dieses auch in die Rechtspraxis umsetzen wollte24). magazin forschung 2/2003 Forschungsdesiderate: Die Friedensbewegung in der Literatur Künftige Untersuchungen dürften unseren Befund der Friedensrechtspraxis nur noch verstärken; als wichtiges Desiderat sei erwähnt die Erforschung des wissenschaftlichen Umgangs mit der Treuga Dei und den Friedensvereinbarungen seit dem Aufkommen der Rechtsschulen bzw. der Gründung der Rechtsfakultäten und dem damit verbundenen Einfluss des römischen wie des gelehrten Rechtes. Es interessieren nicht nur einzelne Rechtsinstitute, etwa die Zeugenregelungen (idoneitas als Voraussetzung für das Ablegen eines Zeugnisses) im Prozess, sondern auch das Auffinden bislang unveröffentlichter Friedenstexte. Schließlich bleibt noch aufgegeben, entsprechende Entwicklungen auf der Iberischen Halbinsel zu ergründen. Wünschenswert wäre auch eine einschlägige Analyse erzählender Quellen, so wie dies Wolfgang Sellert für das Buch III des in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, also in der Stauferzeit entstandenen Tierepos Ysengrimus beispielhaft vorgeführt hat. Aus der Rede des Wolfs ergibt sich, dass er sich nicht einmal scheute, den Frieden am Osterfest, also an einem der laut Sachsenspiegel unter besonderen Friedensschutz gestellten „Heiligen Tage“ zu verletzen, falls damit Vorteile für ihn verbunden wären25). Auch im Ritterepos El Cantar de Mio Cid gibt es Anzeichen für die Kenntnis und die Einbeziehung der Friedensgebote in die damalige Rechtspraxis. Von der gesamten spanischen mittelalterlichen Heldenepik ist der Cid in fast vollständiger Form überliefert. Trotz der einzelnen Datierungsprobleme kann man sagen, dass der Cid in rudimentärer Form über längere Zeit mündlich tradiert wurde, ehe ihn ein begabter und in Rechtsfragen versierter Autor um 1200 in seine strukturierte Form brachte und niederschrieb; sehr wahrscheinlich ist dies der im Schlussvers genannte Per Abad gewesen, der in den Rechtsfragen der Zeit gut unterrichtet war. Der Cid stand in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts im Dienst von König Alfons VI. von Kastilien, der die 1094 vom Cid eroberte Stadt Valencia gegen die Almoraviden nicht halten konnte und sie 1102 völlig niederbrennen ließ. Der Cid kämpfte im Maurengebiet, raubte Ortschaften aus und zwang diese zu Tributzahlungen. Er scheute sich auch nicht, in das Territorium des christlichen Grafen von Barcelona einzudringen und diesen sogar gefangen zu setzen. Gerade in dieser Invasion des Cid auf das Gebiet des Grafen von Barcelona ausgangs des 11. Jahrhunderts kann ein Landfriedensbruch gesehen werden: „Die Kunde von ihm ging nach allen Himmelsrichtungen. Die Nachricht gelangte auch zum Grafen von Barcelona, dass mein Cid Ruy Diaz sein ganzes Land durchzog. Das verdross ihn gar sehr, und er fasste es als schwere Beleidigung auf.“26) Da der Cid Straßen und Wege in der Grafschaft Barcelona verunsicherte, war der usatge 62 berührt, denn diese Regel, die zur „Gran Constitució“ des Grafen Ramón Berenguer I. von Barcelona (um 1060) zählte, schützte die Sicherheit von Straßen und öffentlichen Wegen27). Aus der gleichen Epoche wie der Cid und ebenso aus dem Genre des altspanischen Ritterepos stammt der Cantar de los siete Infantes de Lara, der die Auseinandersetzungen und die Fehde zweier kastilischer Familien enthält28), in deren Verlauf die sieben Infanten getötet und die abgeschlagenen Köpfe ihrem Vater nach Córdoba gebracht wurden. Dort hielt sich als Flüchtling und Gast des arabischen Herrschers al-Mansur der Vater der Infanten auf, dessen Sohn, den er mit einer Muslimin gezeugt hatte, dieses unmenschliche Verbrechen rächen sollte29). Die letztgenannten Texte sind natürlich nur eine Auswahl der in Frage kommenden Literatur. Sie bieten indessen reichlich Material für künftige Analysen unter dem Aspekt der Friedensbewegung, die sich auf der iberischen Halbinsel zusehends ausbreiten konnte. Verweise und Erläuterungen 1) Dietmar Willoweit, Die Sanktionen für Friedensbruch und der Kölner Gottesfriede von 1083. Ein Beitrag zum Sinn der Strafe in der Frühzeit der deutschen Friedensbewegung, in: Ellen Schlüchter/Klaus Laubenthal (Hg.), Recht und Kriminalität. Festschrift für Hermann Krause, Köln 1990, S. 44. 2) Hans-Werner Goetz, La paix de Dieu en France autour de l´an Mil: fondements et objectifs, diffusion et participants, in: Michel Parisse/Xavier Barral i Altet (Hg.), Le Roi de France et son royaume autour de l´an mil, Paris 1992, S. 142-145. 21 3) Thomas Gergen, Le concile de Charroux et la paix de Dieu: Un pas vers l’unification du droit pénal au Moyen Age?, in: Bulletin de la Société des antiquaires de l´Ouest et des Musées de Poitiers (B.S.A.O.), Poitiers 1998, S. 1-58; dem folgend: Rolf Grosse, Der Friede in Frankreich bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts, in: Franz-Reiner Erkens/ Hartmut Wolff (Hg.), Von Sacerdotium und Regnum, Geistliche und weltliche Gewalt im frühen und hohen Mittelalter. Festschrift für Egon Boshof zum 65. Geburtstag, Köln/ Weimar/Wien 2000, S. 86-87. 4) Paul Hinschius, System des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf Deutschland, Berlin 1878-1893, ND Graz 1959, Bd. IV, S. 749-750 und 801. 5) Gerhard Dilcher, Mittelalterliche Rechtsgewohnheit als methodisch-theoretisches Problem, in: Gerhard Dilcher/Heiner Lück/ Reiner Schulze/Elmar Wadle/Dietmar Willoweit/Udo Wolter (Hg.), Gewohnheitsrecht und Rechtsgewohnheiten im Mittelalter (Schriften zur Europäischen Rechts- u. Verfassungsgeschichte 6), Berlin 1992, S. 26. 6) Cécile Treffort, Le comte de Poitiers duc d’Aquitaine, et l’Église aux alentours de l’an mil (970-1030), in: Cahiers de Civilisation Médiévale 43 (2000), S. 395-445. 7) Giovanni Domenico Mansi (Hg.), Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Florenz/Venedig 1759-1798, ND Paris 1899-1927, ND Graz 1961 ff., XIX, 265-268; Ludwig Huberti, Studien zur Rechtsgeschichte der Gottesfrieden und Landfrieden, Ansbach 1892, S. 135 ff.; Roger Bonnaud-Delamare, Les institutions de paix en Aquitaine au XIe siècle, in: Recueils de la Société Jean Bodin, Bd. XIV, Brüssel 1962, S. 437 ff.; Hartmut Hoffmann, Gottesfriede und Treuga Dei (Schriften der MGH 20), Stuttgart 1964, ND 1986, S. 31 ff. 8) So das Konzil von Meaux aus dem Jahre 845: „nec absque metropolitani cognitione et provincialium episcoporum iuditio quemlibet anathematizandum esse permittimus“ (c. 56), siehe Giovanni Domenico Mansi (Hg.), Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Florenz/Venedig 17591798, ND Paris 1899-1927, ND Graz 1961 ff., XIX, 265-268, XIV, 832. Burdegalensis, subscripsi, qui et Aginnensis episcopus“. 11) Olivier Guillot/Yves Sassier, Pouvoirs et institutions dans la France médiévale. Des origines à l´époque médiévale, Bd. 1, 3. Aufl., Paris 1999, S. 81-82. 12) Hans-Werner Goetz, Die Gottesfriedensbewegung im Licht neuerer Forschungen, in: Arno Buschmann/Elmar Wadle (Hg.), Landfrieden, Anspruch und Wirklichkeit (Rechts- und Staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft 98), Paderborn 2002, S. 31-54. 13) Guillot/Sassier, Pouvoirs (Fn. 11), S. 217. 14) Wolter, Die „consuetudo“, in: Dilcher/ Lück/Schulze/Wadle/Weitzel/Wolter (Hg.), Gewohnheitsrecht (Fn. 5), S. 87-116, insbes. S. 101. 15) Daniela Müller, Schuld – Geständnis – Buße. Zur theologischen Wurzel von Grundbegriffen des mittelalterlichen Strafprozessrechts, in: Hans Schlosser/Rolf Sprandel/ Dietmar Willoweit (Hg.), Herrschaftliches Strafen seit dem Hochmittelalter. Formen und Entwicklungsstufen (Konflikt, Verbrechen und Sanktion in der Gesellschaft Alteuropas. Symposien und Synthesen, 5), Köln/Weimar/Wien 2002, S. 418-420; Stefan Kuttner, Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX., Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1935, S. 3. 21) Thomas Gergen, Pax et treuga dans Romanistik et Germanistik, in: Günter Holtus/ Johannes Kramer (Hg.), Miscellanea in honorem Max Pfister septuagenarii oblata Bd. II (Beiträge zur Romanistik 7), Darmstadt 2002, S. 311-320. 22) Thomas Gergen, Paix éternelle et paix temporelle. Tradition de la paix et de la trêve de Dieu dans les compilations du droit coutumier territorial, in: Cahiers de Civilisation Médiévale 45 (2002), S. 165-172. 23) Reinhold Kaiser, Mord im Dom. Von der Vertreibung zur Ermordung des Bischofs im frühen und hohen Mittelalter, ZRG (KA) 110 (1993), S. 95-134, hier S. 127; Elmar Wadle, Landfriedensrecht in der Praxis, in: Buschmann/Wadle (Hg.), Landfrieden (Fn. 12), S. 89-92. 24) Thomas Gergen, Gottesfrieden und Gewalt gegen Bischöfe. Überlegungen zu den Rechtsgrundlagen des Sanktionensystems, in: Natalie Fryde/Dirk Reitz (Hg.), Bischofsmord im Mittelalter. Murder of Bishops (Veröffentlichungen des MaxPlanck-Instituts für Geschichte 191, Kolloquium 21.-24. September 2000), Göttingen 2003, S. 83-97. 16) M. Lambert, Péché, in: Dictionnaire du Moyen Age, Claude Gauvard et al. (Hg.), 2. Auflage, Paris 2002, S. 1061-1062. 25) Wolfgang Sellert, Das Verfahren gegen den Wolf aus der Sicht des Rechtshistorikers, in: Ulrich Mölk (Hg.), Literatur und Recht. Literarische Rechtsfälle von der Antike bis in die Gegenwart (im Auftrag der Akademie der Wissenschaften), Göttingen 1996, S. 5780. 17) Thomas Gergen, Et meam considerans culpam ...- La paix de Dieu comme source juridique pour la résolution des conflits, in: La Culpabilité (C.I.A.J. 6), Limoges 2001, S. 376-380. 26) Übersetzung der Laisses 55 und 56 (v. 957-966) übernommen von Hans-Jörg Neuschäfer, El Cantar de Mío Cid (Klassische Texte des Romanischen Mittelalters), München 1964, S. 90-91. 18) Dilcher, Mittelalterliche Rechtsgewohnheit (Fn. 5), S. 53-55 und 63; Jürgen Weitzel, Gewohnheitsrecht und fränkischdeutsches Gerichtsverfahren, in: Dilcher/ Lück/Schulze/Wadle/Weitzel/Wolter (Hg.), Gewohnheitsrecht (Fn. 5), S. 79. 27) Gener Gonzalvo i Bou, La Pau i Treva a Catalunya. Origen de les Corts Catalanes, Barcelona 1986, S. 105. 9) Hinschius, System (Fn. 4), Bd. V, S. 278. 19) Thomas Gergen, The Peace of God and its Legal Practice in the Eleventh Century, in: Cuadernos de Historia del Derecho, Bd. 9, Madrid 2002, S. 11-27. 10) Pierre Delalande (Hg.), Conciliorum antiquorum Galliae a Jac. Sirmondo, S.J., editorum supplementa nunc prodeunt, opera et studio Petri Delalande, Paris 1666, S. 328: „Ego Gumbaldus, archiepiscopus 20) Thomas Gergen, Droit canonique et protection des „cercles de paix“ - Le vocabulaire de la protection, droit, in: La protection spirituelle au moyen âge (XIIIe-XIVe siècle), Cahiers de Recherches Médiévales, Bd. 8, 22 Orléans 2001, S. 135-142. 28) Thomas Gergen, Zur mittelalterlichen Gottes- und Landfriedensbewegung in Katalonien. Ein Forschungsbericht, in: Mitteilungen des Deutschen Katalanistenverbandes 40 (2001), S. 54-62. 29) Manfred Tietz, Die frühen Werke der spanischen Literatur, in: Hans-Jörg Neuschäfer (Hg.), Spanische Literaturgeschichte, Stuttgart 1997, S. 30. Universität des Saarlandes
Baixar